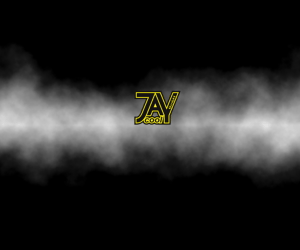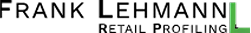ESMA vs. MiCA: Verliert die EU bei der Krypto-Aufsicht den Kurs?

Die europäische Krypto-Regulierung gleicht derzeit einem Großprojekt, das nach langer Planung endlich auf der Zielgeraden angekommen schien und nun plötzlich Baustellenschilder an Stellen aufstellt, an denen eigentlich frisch asphaltierte Straßen liegen sollten. MiCA wurde als ambitioniertes Fundament präsentiert, das Krypto-Dienstleister durch klare Regeln und einheitliche Standards in geordnete Bahnen lenken sollte, während nationale Behörden die Rolle der Lotse übernehmen.
Genau dieses Gefüge könnte sich nun jedoch verschieben, weil die Europäische Kommission überlegt, ob ESMA direkt das Steuer übernehmen soll. Das wirft eine Menge Fragen auf, zumal sich das Projekt in einer sensiblen Phase befindet und die Akteure längst mitten in der Umsetzung stecken.
Die ursprüngliche Architektur von MiCA
MiCA entstand mit dem Ziel, einen Markt zu regulieren, der sich lange wie ein ungezügeltes Gelände anfühlte und in dem vielerorts nationale Alleingänge wucherten. Der Ansatz war vergleichsweise pragmatisch gehalten, weil die EU nicht sofort die harte Keule zentraler Kontrolle schwingen wollte. Stattdessen sollten nationale Aufsichtsbehörden Zulassungen für sogenannte Crypto Asset Service Provider vergeben, woraufhin diese Unternehmen über das bekannte Passporting-Prinzip EU-weit operieren dürfen.
Dieses Konstrukt versprach einen brauchbaren Mittelweg, der einheitliche Regeln schafft und gleichzeitig die regionalen Besonderheiten respektiert, denn Behörden vor Ort kennen ihre Märkte immer noch besser als jede übergeordnete Stelle in einem Brüsseler Büro. In diesem Rahmen tauchte auch immer häufiger die grundsätzliche Frage auf, welche Kryptos Sie kaufen sollten, da MiCA erstmals eine verbindliche Struktur schuf, anhand derer sich Projekte und Anbieter seriöser voneinander abgrenzen lassen.
Auch der Zeitplan war bewusst in Etappen gegliedert. Stablecoins und andere Token-Kategorien sollten früh ins Regime fallen, während Dienstleister erst im Laufe von 2024 und 2025 vollständig integriert werden. Viele Mitgliedstaaten haben sich längst darauf eingestellt. Behörden bauen Teams auf, bereiten Verfahren vor und weisen Firmen darauf hin, welche Dokumentation sie künftig vorlegen müssen. Damit wirkt MiCA bereits jetzt wie ein sorgfältig synchronisiertes Uhrwerk, das noch ein paar Zahnräder braucht, um rundzulaufen.
Warum plötzlich alles anders werden soll

Während MiCA also langsam Form annimmt, reist ausgerechnet aus Brüssel die Nachricht an, dass die europäische Aufsicht ESMA künftig nicht nur koordinieren soll, sondern selbst Zulassungen erteilen könnte. Die Pläne würden das gesamte Regelmodell verändern, denn die zentrale Frage lautet inzwischen, ob eine kontinentale Behörde den föderalen Mechanismus ersetzen sollte. Die Kommission argumentiert mit der grenzüberschreitenden Natur des Kryptomarktes und führt an, dass eine Vielzahl nationaler Interpretationen Unstimmigkeiten schaffen könnte.
Einige Mitgliedstaaten begrüßen diesen Gedanken. Frankreich positioniert sich besonders deutlich und drängt auf eine starke zentrale Instanz, die die Durchsetzung konsequent überwacht. Andere Länder sind weniger begeistert, vor allem solche, die in den vergangenen Jahren eigene Strukturen geschaffen haben und befürchten, dass Investitionen in Personal und Aufsichtskapazitäten plötzlich ihren Wert verlieren. In Staaten mit aktiver Kryptoindustrie taucht in den Branchen-News zudem die Sorge auf, dass ein zentraler Aufseher die Nähe zum Markt verliert und Entscheidungen träger ausfallen könnten.
Inmitten von Marktkenntnis und Machtkonzentration
Die Verfechter einer zentralen Lösung führen an, dass ein einzelner Aufseher ein deutlich klareres und strengeres Gesamtbild erzeugt. Unterschiedliche Interpretationen verschwinden, der Markt wird planbarer und grenzüberschreitende Risiken lassen sich besser erkennen. Darüber hinaus verspricht ein zentraler Ansatz mehr Konsistenz, denn nationale Behörden haben nicht alle dieselbe Größe oder dieselben Ressourcen, was in der Praxis zu Unterschieden bei Aufsichtstiefe und Fachkompetenz führen kann.
Gegner dieser Idee verweisen wiederum auf die Stärken der dezentralen Struktur. Nationale Behörden haben Erfahrung, kennen lokale Besonderheiten und verfügen über gewachsene Kontakte zu Branchenakteuren. Dieses Wissen einfach an eine zentrale Behörde zu verlagern, könnte zu Reibungsverlusten führen.
Zudem stellt sich die Frage, ob ESMA überhaupt in der Lage wäre, die Masse an Anträgen zu bewältigen, die aktuell auf die Mitgliedstaaten zukommt. Selbst wenn Aufgaben delegiert werden, bleibt die operative Last zunächst bei ESMA hängen und die Behörde müsste innerhalb kürzester Zeit Fachwissen und Personal im großen Stil aufbauen.
Rechtliche Sicherheit spielt ebenfalls eine Rolle. MiCA wurde in der Wirtschaft breit kommuniziert und viele Unternehmen haben Prozesse bereits an den kommenden europäischen Rahmen angepasst. Eine kurzfristige Richtungsänderung würde nicht nur Behörden irritieren, sondern auch Firmen, die darauf angewiesen sind, dass ihre Planungen nicht im Nebel verschwinden.
Wenn eine Verordnung ihre Richtung verliert
Noch ist völlig unklar, welche Aufgaben nationale Aufsichten unter einem ESMA-Modell verbleiben würden. Manche Szenarien sehen eine Aufteilung vor, andere wiederum einen fast vollständigen Kompetenztransfer. Auch der Umgang mit bereits laufenden oder im Aufbau befindlichen Zulassungsverfahren bleibt eine offene Baustelle. Ein abruptes Umschalten auf Brüssel würde Verfahren möglicherweise zum Stillstand bringen und damit den Markt bremsen.
Hinzu kommt das Ressourcenproblem. ESMA müsste sich in extrem kurzer Zeit von einem strategischen Aufseher zu einer operativen Frontbehörde mit Hunderten von Verfahren pro Jahr entwickeln. Das birgt erhebliche Risiken, denn selbst bei ambitionierter Einstellungspolitik bleiben Fragen nach Erfahrung, Qualitätssicherung und Priorisierung. Je größer die Behörde, desto schwieriger wird es zudem, den Überblick über sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle zu behalten, besonders in einem Marktsegment, das so schnell mutiert wie Krypto-Assets.
Kommt die EU vom Kurs ab?
Die Diskussion lässt sich als Konflikt zwischen Stabilität und Optimierungsdruck verstehen. MiCA begann als sorgfältig ausgehandelter Kompromiss, der die Balance zwischen europäischer Einheitlichkeit und nationaler Marktkenntnis halten sollte.
Die Frage, ob diese Balance im Licht aktueller Entwicklungen noch trägt, ist nicht unberechtigt. Der Kryptomarkt wächst, internationale Akteure drängen hinein und Regulierungsarbitrage bleibt ein aktuelles Thema. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass MiCA gerade erst Fahrt aufnimmt und ein radikaler Eingriff das Vertrauen in den gesamten Rahmen untergraben könnte.
Eine Regulierung mit Anspruch, Realität und politischem Ringen
Die EU befindet sich in einem Spannungsfeld aus Praktikabilität, politischem Gestaltungswillen und dem Anspruch, einen fairen und stabilen Kryptomarkt zu schaffen. MiCA war als solide Grundlage angelegt und wird von vielen als notwendiges Gerüst gesehen, das nun erst einmal stehen muss, bevor daran weitergebaut wird.
Die Debatte um ESMA zeigt jedoch, dass der politische Prozess längst weiterdenkt. Ob es sich um eine Kursabweichung oder eine Kurskorrektur handelt, hängt am Ende davon ab, wie die EU die offenen Fragen beantwortet und ob der Regulierungsrahmen die notwendige Klarheit bekommt, die ein junger und dynamischer Markt dringend braucht.
Was haltet ihr von diesem Thema? Bitte schreibt uns indes eure Meinung auf Supermarkt Inside.
Foto: Archiv Supermarkt-Inside und wir gekennzeichnet.